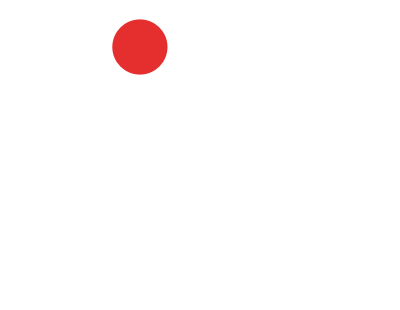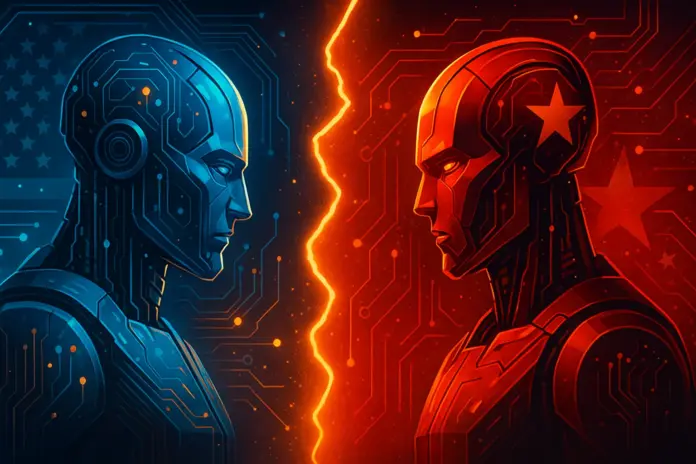Beim KI-Wettlauf geht es nicht mehr nur um Algorithmen und Chips, sondern auch darum, wer die Energie kontrolliert, die sie speist. China hat einen enormen Vorteil, den es mit enormen Investitionen in Wasserkraft, Kernkraft und erneuerbare Energiequellen aufgebaut hat. So hat es Zugang zu reichlich vorhandenem und billigem Strom und verfügt teilweise über 80-100 % Netzreserven. Die Rechenzentren der KI werden nicht als Bedrohung für die Netzstabilität angesehen, sondern als eine Möglichkeit, ein Überangebot an Strom aufzufangen.
Im Gegensatz dazu steckt das US-Netz aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz in ernsthaften Schwierigkeiten. Steigende Kosten, Engpässe und lückenhafte Expansion zwingen private Unternehmen dazu, ihre eigenen Microgrids zu bauen, Atomabkommen anzustreben oder sogar Gasgeneratoren zu betreiben, nur um KI-Server am Laufen zu halten.
China profitiert von einer technokratischen, langfristigen Planung. Energieerzeugung, -übertragung und -KI-Infrastruktur werden durch zentralisierte Fünfjahrespläne koordiniert, die sicherstellen, dass die Energiesysteme die Nachfrage antizipieren, anstatt aufzuholen. Die Vereinigten Staaten leiden unterdessen unter fragmentierter Regulierung, langwierigen Genehmigungsverfahren und einem Kapitalmarkt, der schnelle Renditen in den Vordergrund stellt, was es schwierig macht, die robusten, zukunftssicheren Energienetze aufzubauen, die von KI benötigt werden.
Infolgedessen kann Amerika derzeit an der Front der Energieinfrastruktur nicht effektiv konkurrieren. In den Vereinigten Staaten ist das Wachstum der künstlichen Intelligenz zunehmend mit Debatten über den Energieverbrauch von Rechenzentren und die Grenzen des Netzes verbunden, was in krassem Gegensatz zu China steht.
Übersetzt und bearbeitet Alex Kada